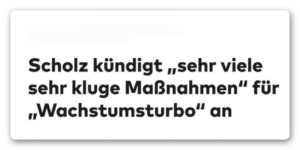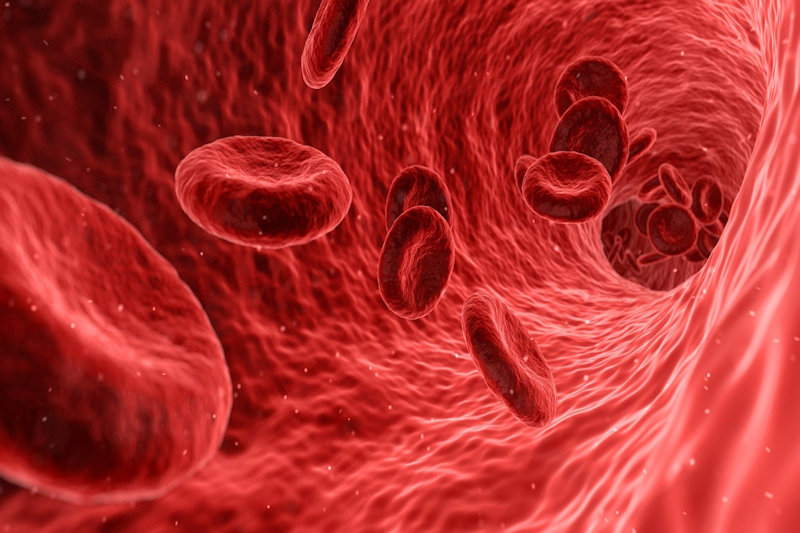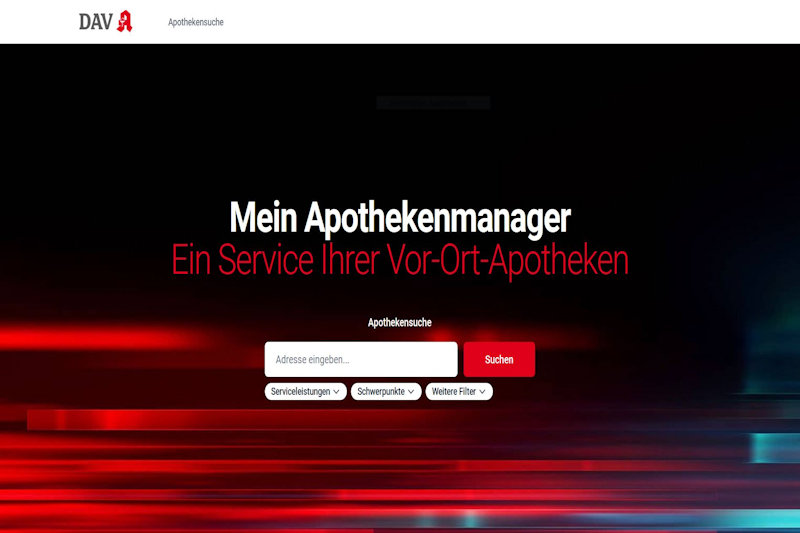Monat: Juli 2021
Huskies und Roosters kooperieren – Jonas Neffin kommt per Förderlizenz
[metaslider id=10234] Kassel, 30. Juli, 2021. Neuer PENNY DEL-Kooperationspartner für die Kassel Huskies: Die Schlittenhunde arbeiten in der kommenden Saison mit den Iserlohn Roosters zusammen. [more…]
Hessen ist bunt, Vielfalt bereichert uns
[metaslider id=10234] Als Zeichen für das weltoffene und vielfältige Hessen hissen das Hessische Ministerium für Soziales und Integration, das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, [more…]
Last-Minute-Ziele für Camper in der Hochsaison – online reservieren
[metaslider id=10234] Wer den Camping-Urlaub auf den letzten Drücker genießen will, muss sich sputen. Der Run auf die Campingplätze in Deutschland und in beliebten [more…]
Abgasskandal: Was Verbraucher über das Verjährungs-Verfahren am BGH wissen müssen
[metaslider id=10234] Die Richter am Bundesgerichthof (BGH) haben heute eine verbraucherfreundliche Entscheidung im Rahmen des Abgasskandals getroffen. Demnach hängt der Eintritt der Verjährungsfrist in [more…]
Gewerbesteuereinnahmen im ersten Halbjahr 2021 gestiegen
[metaslider id=10234] Die hessischen Kommunen haben im ersten Halbjahr 2021 ein Gewerbesteueraufkommen von 2,76 Milliarden Euro erzielt. Gegenüber dem Vorjahrszeitraum stiegen die Gewerbesteuereinnahmen um 28,0 [more…]
Nach der Flut: Gefährliche Keime in Wasser und Schlamm
[metaslider id=10234] Zwei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe sind die Aufräumarbeiten noch immer in vollem Gange. Doch dabei ist größte Vorsicht geboten: Das Wasser und [more…]
Bezeichnung als „Ming Vase“ ist rassistische Beleidigung – Kündigung gerechtfertigt
[metaslider id=10234] Berlin (DAV). Wer seine Vorgesetzte als „Ming Vase“ bezeichnet und eine Geste des Nach-Hinten-Ziehens der Augen macht, kann fristlos gekündigt werden. Insbesondere, wenn [more…]
Analyse der Deutschen Umwelthilfe deckt gravierendes Palmöl-Problem in Futtermittel-Industrie auf
[metaslider id=10234] Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) deckt mit einer neuen Analyse ein gravierendes Palmöl-Problem in der Futtermittel-Industrie auf: Für den “Futtermittel-Radar” der DUH wurden [more…]
Einbruch in Juweliergeschäft gescheitert: Kripo sucht Zeugen
[metaslider id=10234] (ots) Kassel-Mitte: In der Nacht zum heutigen Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in der Wolfsschlucht, nahe der Kölnischen Straße, [more…]
Landkreis Kassel, Gemarkung Wolfhagen: Tödlicher Verkehrsunfall
[metaslider id=10234] (ots) Am frühen Samstagmorgen, 31.07.2021, gegen 00:40 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Wolfhagen ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger männlicher PKW-Fahrer aus Bad [more…]
Festnahmen nach Schockanruf durch Betrüger in Ahnatal
[metaslider id=10234] (ots) Ahnatal (Landkreis Kassel): Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo ist am Donnerstagabend gemeinsam mit Zivilfahndern der Operativen Einheit der Polizeidirektion Kassel [more…]
„Schnelle Einsatzkommunikation für mehr Sicherheit“
[metaslider id=10234] Alle hessischen Polizisten werden bis Ende 2022 mit Smartphones ausgestattet / Innenminister und Digitalministerin besuchen „INNOVATION HUB 110“ Wiesbaden/Frankfurt. Ob zur Verkehrsunfallaufnahme, der [more…]
Kein Zugverkehr am 31.7 und 1.8. zwischen Bad Wildungen und Kassel – Busse ersetzen Verbindungen auf RB 39
[metaslider id=10234] Die KHB kann aufgrund von Personalmangel am kommenden Wochenende die Regionalbahnstrecke RB 39 Kassel – Bad Wildungen nicht bedienen. Die Details finden Sie [more…]

Tickende Bombe Eswatini
[metaslider id=10234] Der Konflikt in Eswatini steht nach Befürchtungen der SOS-Kinderdörfer kurz vor einer weiteren Eskalation. “Wir sitzen auf einer tickenden Bombe”, sagt Loretta [more…]
Statistischer Bericht zum Erntejahr 2021 veröffentlicht
[metaslider id=10234] Im Erntejahr 2021 haben die Anbauflächen für Winterweizen (plus 4,8 Prozent) und Winterraps (plus 6,7 Prozent) in Hessen gegenüber 2020 zugenommen. Dagegen nahm [more…]
NABU: Auswirkungen künftiger Hochwasserereignisse reduzieren
[metaslider id=10234] Die Folgen der Extremwetterereignisse im Westen und Süden Deutschlands sind dramatisch. Dort kamen verschiedene Faktoren zusammen, die letztendlich zu der Katastrophe mit [more…]
Der KSV im Kalten Krieg – Rückblick mit Historikern und Zeitzeugen
[metaslider id=10234] Der Kasseler Fußball war ein Austragungsort der Auseinandersetzung zwischen West und Ost. Darum geht es in einer Veranstaltung aus Anlass des 60. Gedenkjahres [more…]
Schlafstörungen: Schlechter Schlaf oder schon Insomnie?
[metaslider id=10234] Jeder schläft mal schlecht. Das kann insbesondere an heißen Sommernächten vorkommen. Dauert schlechter Schlaf länger an, fragen sich viele, ob möglicherweise eine [more…]
Anklage gegen syrischen Arzt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit u.a. erhoben
[metaslider id=10234] (ots) Die Bundesanwaltschaft hat am 15. Juli 2021 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main Anklage gegen den syrischen Staatsangehörigen Alaa M. [more…]
Bad Zwesten – Ideenwettbewerb für einen Namen des Hallenbades in der Gemeinde gestartet
[metaslider id=10234] Bad Zwesten – Die Kurverwaltung hat für das Hallen und Bewegungsbad einen Ideenwettbewerb gestartet um einen neuen Namen zu finden. Derzeit wird [more…]
Versorgung mit Blutkonserven kritisch
[metaslider id=10234] In den Sommermonaten wird regelmäßig die Versorgung mit Blutkonserven knapp. Nun wird durch die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz die Situation verschärft. [more…]
Wasserstoff-Erzeugung: Thüga investiert in Pyrolyse-Studie
[metaslider id=10234] Pyrolyse zählt zu den aussichtsreichen Verfahren für die Erzeugung von Wasserstoff. Welche Rolle sie für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft spielen kann, untersucht [more…]

4.936 Euro Förderung für die Freiwillige Feuerwehr Sontra-Stadthosbach
[metaslider id=10234] Der Sprecher der Hessischen Landesregierung, Staatssekretär Michael Bußer, hat am Donnerstag einen Förderbescheid in Höhe von 4.936 Euro an Thomas Bode vom [more…]
POL-KB: Korbach / Bad Arolsen “Polizeiladen on Tour” in Nordhessen: Beratung zu den Themen Einbruchschutz und Trickdiebstahl/ Betrug – Termine im Landkreis Waldeck-Frankenberg
[metaslider id=10234] (ots) Das Team des Polizeiladens, der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, ist im Sommer 2021 wieder in Nordhessen unterwegs und bietet vielerorts kostenlose [more…]
Die gute Nachricht des Tages: Digitale Impfzertifikate schrittweise wieder in Apotheken erhältlich
[metaslider id=10234] (ots) Die Apotheken beginnen schrittweise wieder mit dem Ausstellen von digitalen Impfzertifikaten für Bürgerinnen und Bürger, die gegen das Coronavirus geimpft sind. Auf [more…]
Fristlose Kündigung wegen Küssens gegen den Willen einer Kollegin
[metaslider id=10234] Köln/Berlin (DAV). Wer Kolleginnen oder Kollegen sexuell belästigt, kann fristlos gekündigt werden. Er verletzt damit seine Pflicht, auf die „berechtigten Interessen seines Arbeitgebers [more…]
Führung in der Sonderausstellung „Es lebe der Sport!“
[metaslider id=10234] Das Stadtmuseum lädt am Sonntag, 1. August 2021, um 15 Uhr zu einer Führung durch die Sonderausstellung „Es lebe der Sport!“ ein. Alltag [more…]
GBA: Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied des “Islamischen Staates” erhoben
[metaslider id=10234] (ots) Die Bundesanwaltschaft hat am 7. Juli 2021 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg Anklage gegen die deutsche Staatsangehörige Leonora M. erhoben. Die [more…]
Kräfte bündeln, um Glasfaserausbau im ländlichen Raum voranzutreiben
[metaslider id=10234] Eine hochleistungsfähige Infrastruktur ist unverzichtbare Voraussetzung für die Digitalisierung Hessens. Um zusätzliche Ausbaukapazitäten zu generieren, rief das Land Hessen im vergangenen Herbst [more…]

Fregatte “Bayern” zeigt Flagge im Indo-Pazifik
[metaslider id=10234] ots) Am Montag, den 2. August 2021 um 14 Uhr, heißt es für die Fregatte “Bayern” und ihre Besatzung “Leinen los”. Das Schiff [more…]
Ausgenutzt und ausgelaugt
[metaslider id=10234] Am Donnerstag ist Welterschöpfungstag, auch bekannt als Earth Overshoot Day. Rund fünf Monate vor dem Jahresende haben wir alle biologischen Ressourcen aufgebraucht, [more…]
Schlange unter Mülltonne jagt Schauenburgerin gehörigen Schrecken ein: Besitzer von Zwergpython gesucht
[metaslider id=10234] (ots)Schauenburg (Landkreis): Einen gehörigen Schrecken bekam am gestrigen Dienstagabend eine Frau in Schauenburg, als sie gegen 19:30 Uhr ihre Mülltonne rausstellen wollte und [more…]
Ferien und Staus im ganzen Land Am Wochenende sind in allen Bundesländern Ferien
[metaslider id=10234] An diesem Wochenende befinden sich für zwei Tage alle Bundesländer in den Ferien. Bayern und Baden-Württemberg starten, in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg [more…]
Bundesgerichtshof bestätigt Urteil im bundesweit ersten Cum-Ex-Strafverfahren
[metaslider id=10234] Urteil vom 28. Juli 2021 – 1 StR 519/20 Bisheriger Prozessverlauf und Sachverhalt: Das Landgericht hat den Angeklagten S. im Zusammenhang mit [more…]
Vegane Kost ist gesund – wenn nichts fehlt Wer keine tierischen Lebensmittel isst, sollte auf seine Nährstoffversorgung achten
[metaslider id=10234] Wer auf Fleisch, Fisch, Eier und Milch verzichtet, reduziert gleichzeitig auch Mineralstoffe wie Kalzium und Spurenelemente wie Eisen, Jod, Zink oder Selen. Vegane [more…]
Kapriolen am Rohölmarkt – Spritpreise steigen leicht
[metaslider id=10234] Brent-Öl klettert um vier US-Dollar / ADAC: Intensiverer Wettbewerb trägt zur Senkung der Kraftstoffpreise bei Obwohl der Preis für Rohöl in den vergangenen [more…]
Neue Regeln für die Impfzentren – mobile Impfaktionen in den Kommunen geplant
[metaslider id=10234] Calden/Landkreis Kassel. Das Land Hessen hat einen neuen Einsatzbefehl für die Impfzentren in Hessen übersandt. „Die drei wichtigsten Punkte für die Bürger und [more…]
Korbach – Polizei sucht vermissten Oliver R. und bittet um Hinweise
[metaslider id=10234] (ots) Bereits seit mehreren Tagen wird der 22-jährige Oliver R. aus Korbach vermisst. Zuletzt wurde er am Freitag, 23. Juli, von einem Bekannten [more…]
Oberbürgermeister Geselle ordnet Dezernate und Zuständigkeiten neu
[metaslider id=10234] Im Kasseler Rathaus ändern sich zum 1. August 2021 einige Zuständigkeiten. Oberbürgermeister Christian Geselle übt das ihm durch die Hessische Gemeindeordnung zustehende Dezernatsverteilungsrecht [more…]
Ringelnatter am Gartenteich
[metaslider id=10234] NABU-Tipps zum Umgang mit heimischen Schlangen Wetzlar – Ob an Bahndämmen, trockenen Wegrändern, sonnigen Plätzen auf Wiesen oder am lauschigen Gartenteich – [more…]
Internationale PhysikOlympiade: Jonas Hübner aus Kassel sichert sich Silbermedaille
[metaslider id=10234] HESSENMETALL und Kultusminister gratulieren dem Ausnahmetalent Kassel/Wiesbaden. Kluge Physiker braucht die Welt – und die Industrie. Jonas Hübner, Schüler am Friedrichsgymnasium in Kassel, [more…]
Verstärken ab sofort das Management der Kassel Huskies: Matthias Hamann und Daniel Lammel
[metaslider id=10234] Kassel, 27. Juli, 2021. Zwei Top-Größen aus der deutschen Sport-Szene gehen künftig gemeinsame Wege mit den Kassel Huskies. Für viele dürften Matthias Hamann [more…]
Greenpeace untersucht die Böden und Gewässern im Hochwassergebiet auf Verunreinigungen durch Schadstoffe
[metaslider id=10234] Blessem – Greenpeace-Expert:innen nehmen ab heute stichprobenartig Boden- und Wasserproben im nordrhein-westfälischen Katastrophengebiet rund um den stark beschädigten Ort Blessem. In einem [more…]

Bürgermeisterin Ilona Friedrich empfängt Hilfskräfte aus Krisengebiet
[metaslider id=10234] Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Katastrophenschutzes, die von Kassel aus in die Krisengebiete in Rheinland-Pfalz aufgebrochen waren, sind inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt. Am Freitagabend [more…]
Typ-2-Diabetes: Blutzuckerwerte verbessern – ohne Insulin
[metaslider id=10234] Für Patienten mit Typ-1-Diabetes ist Insulin überlebenswichtig. Bei Menschen mit Typ 2 ist Insulin dagegen nicht immer eine gute Wahl. Denn das Insulin bewirkt, dass [more…]
Erfolgreicher Abschluss: Stadt Kassel übernimmt fast alle Auszubildenden
[metaslider id=10234] 33 junge Menschen haben ihre Abschlussprüfungen absolviert und ihre Ausbildungen beziehungsweise ihr duales Studium bei der Stadt Kassel erfolgreich beendet. Fast alle werden [more…]
„Behördengänge vom Sofa erledigen“
[metaslider id=10234] Eine Geburtsurkunde beantragen, einen Hund zur Steuer bei der Kommune anmelden oder einen Parkausweis für Schwerbehinderte beantragen. Die Liste an Leistungen, die [more…]
Der deutsche Handball ist solidarisch in der Hochwasser-Katastrophe und beteiligt sich an Spendenaktionen
[metaslider id=10234] Handballer melden sich aus Tokio – LIOUI MOLY HBL, 2. Handball-Bundesliga und Deutscher Handballbund engagieren sich bei „Aktion Deutschland Hilft“ Durch zahlreiche Hilfsaktionen [more…]
Überleben nach Herzstillstand: Freiburger Herzchirurg*innen entwickeln neue Technik
[metaslider id=10234] Forscher*innen des Universitätsklinikums Freiburg und der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg haben einen Therapieansatz entwickelt, mit dem Menschen nach einem Herzstillstand deutlich [more…]
Das Wunder von Gibraltar: 85% Impfquote und Inzidenz bei 600
[metaslider id=10234] Gibraltar (HIER), die britische Enklave an der Südspitze von Spanien, hat trotz einer offiziellen Impfquote von 100% ihrer 34.000 Einwohner nun eine [more…]