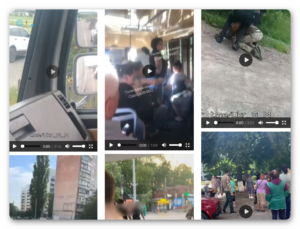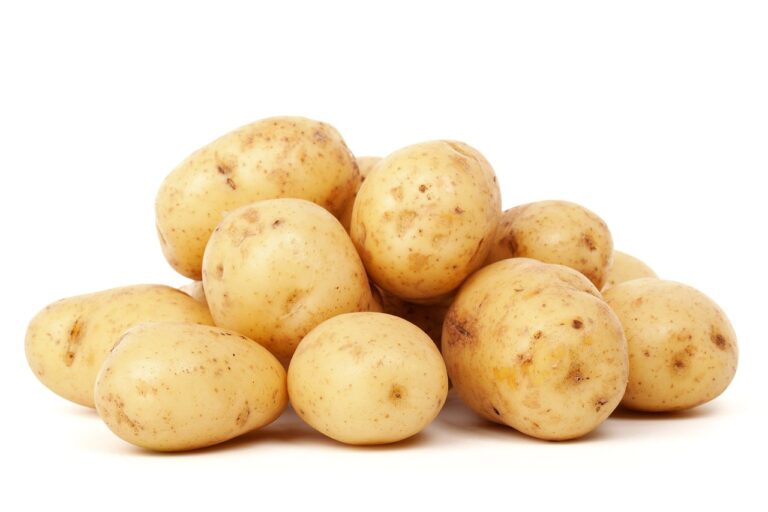Monat: Oktober 2020
Landkreis Werra-Meißner, Eschwege: Versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten
[metaslider id=10234] (ots) Bisher unbekannte Täter versuchten heute in den frühen Morgenstunden gegen 03:50 Uhr den Geldausgabeautomaten der Commerzbank in Eschwege zu sprengen. Die Tat [more…]
Umweltbundesamt zu mobilen Lufteinigern: Nur im Ausnahmefall sinnvoll
[metaslider id=10234] Vor dem Hintergrund einer möglichen Übertragung des SARS-CoV-2-Virus über Aerosole in Räumen werden mobile Luftreinigungsgeräte (d. h. frei im Raum aufstellbare Geräte) derzeit [more…]
Neuer Podcast zu: Machtspiele, Mitarbeiterbegeisterung und Führung
[metaslider id=10234] „Wollten Sie schon immer mal wissen, wie es im Konzernalltag mitunter zugeht, welche Machtspiele und Intrigen dort gespielt werden und wie man sich [more…]
PÜRSÜN (FDP) : Landesregierung gesteht Scheitern ein
[metaslider id=10234] Kontaktnachverfolgung nicht mehr möglich Öffentlicher Gesundheitsdienst hätte frühzeitig gestärkt werden müssen Manche Quarantäne-Anordnungen sind unverhältnismäßig WIESBADEN – „Die Landesregierung hat es jetzt selbst [more…]
MT empfängt selbstbewusste Nordhorner
[metaslider id=10234] Das zuletzt im erfolgreichen Hessenderby gezeigte Level wieder zu erreichen, das ist der erklärte Anspruch der MT Melsungen zum Heimspiel am kommenden Sonntag. [more…]
Preisträger des Wettbewerbs zur Neugestaltung des Brüder-Grimm-Platzes stehen fest
[metaslider id=10234] Der freiraumplanerische Realisierungswettbewerb zur Neugestaltung des Brüder-Grimm-Platzes ist abgeschlossen. Nach der gestrigen Sitzung der Jury gehen zwei erste Preise an das Büro club [more…]
Alle Museen und Schlösser der Museumslandschaft Hessen Kassel bleiben vom 2. bis zum 30. November geschlossen – Die Parks bleiben geöffnet
[metaslider id=10234] Die Museumslandschaft Hessen Kassel schließt vom 2. bis 30. November 2020 alle Museen und Schlösser. Geöffnet bleiben die Parkanlagen (Bergpark Wilhelmshöhe, Staatspark Karlsaue [more…]
Knappe Niederlage nach großem Kampf – Huskies verlieren Testspiel gegen Eisbären Berlin mit 1:3
[metaslider id=10234] Kassel, 30. Oktober 2020. Im finalen Vorbereitungsspiel der Kassel Huskies auf die am 6. November beginnende DEL2-Saison setzte es für die Schlittenhunde eine [more…]
Folgemeldung zu Schüssen auf Friedrich-Ebert-Straße: 34-Jähriger dringend tatverdächtig
[metaslider id=10234] (ots) Kassel: Nachdem ein 18-Jähriger in der Nacht zum Sonntag auf der Friedrich-Ebert-Straße durch Schüsse verletzt worden war, haben die Kasseler Ermittlungsbehörden den [more…]
Waldeck-Frankenberg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 3076 zwischen Adorf und Flechtdorf.
[metaslider id=10234] (ots)Auf der L 3076 zwischen Adorf und Flechtdorf kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Mann tödlich verletzt [more…]
Milo im Kasseler Eichwald weggelaufen
[metaslider id=10234] [pdf-embedder url=”http://nordhessen-journal.de/wp-content/uploads/2020/10/TASSO_Suchplakat_S2528380.pdf”] [metaslider id=20815]
Mit Besen und Rechen für mehr Leben im Garten
[metaslider id=10234] NABU Hessen bittet darum, im Garten auf Laubsauger zu verzichten Wetzlar – Angesichts bunter Laubmassen in Gärten und auf Wegen scheint der Griff [more…]
ROCK ( FDP) : Notstandsbegriff erzeugt falsches Bild
[metaslider id=10234] Freie Demokraten kritisieren Bouffiers Wortwahl Lagebeschreibung muss mit Fakten unterlegt werden Erkenntnisse gewinnen, um gezielte Maßnahmen zu ergreifen WIESBADEN – René ROCK, Fraktionsvorsitzender [more…]
Geisternetze – die unsichtbare Gefahr
[metaslider id=10234] Plastik im Meer wird mit herumschwimmenden Verpackungen oder weggeworfenen Plastikflaschen assoziiert. Doch mindestens ein Drittel des weltweiten Plastikmülls in den Ozeanen besteht [more…]
Tierheimtier des Monats – Bailey
[metaslider id=10234] Deutscher Tierschutzbund kürt Tierheimtier des Monats November: Boxer Bailey sucht ein neues Zuhause Der Deutsche Tierschutzbund hat den fünf Jahre alten weißen Boxer [more…]
Flüchtlingsland Tunesien: Jetzt fliehen nach Angaben der SOS-Kinderdörfer sogar Familien mit Kleinkindern über das Meer
[metaslider id=10234] (ots) Erst flohen die jungen Männer, jetzt immer öfter ganze Familien: Um der Not und Armut, die durch die Corona-Maßnahmen noch verstärkt wurden, [more…]
Aktualisierte Broschüre “A bis Z – Älterwerden in Kassel” erschienen
[metaslider id=10234] Alle Informationen rund um das Älterwerden liefert die Stadt mit der aktualisierten Broschüre “A bis Z – Älterwerden in Kassel”. Der 90 Seiten [more…]
Bad Zwesten – L 3296 Ortsdurchfahrt Bergfreiheit: Beginn des zweiten Bauabschnitts
[metaslider id=10234] Bad Zwesten – Hessen Mobil erneuert die Fahrbahn der Landesstraße L 3296 im Bereich der Ortsdurchfahrt von Bergfreiheit in zwei Bauabschnitten auf [more…]
Stadt Kassel appelliert: Auf Halloween-Partys verzichten
[metaslider id=10234] Die Stadt Kassel appelliert an Eltern, Kinder und Jugendliche, in diesem Jahr auf Halloween-Partys zu verzichten. Auch der Gang von Haustür zu Haustür [more…]
Kassel Huskies testen gegen den Penny DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin – SpradeTV berichtet live
[metaslider id=10234] Kassel, 29. Oktober, 2020. Über zehn Jahre ist es her, dass sich Kassel Huskies und Eisbären Berlin auf dem Eis begegneten. Morgen feiert [more…]
Raubüberfall im Juni auf Tankstelle in Niederzwehren: Kripo ermittelt Tatverdächtigen
[metaslider id=10234] (ots)Kassel-Niederzwehren: Bei den Ermittlungen zu dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Kassel am 11. Juni 2020 konnten die [more…]
Bier-Adventskalender bringt die Region nach Hause
[metaslider id=10234] 15 Brauereien und die Bathildisheimer Werkstätten kooperieren mit der GrimmHeimat NordHessen Bereits im dritten Jahr macht der Bier-Adventskalender der GrimmHeimat NordHessen die Vorweihnachtszeit [more…]
MT Melsungen auch gegen Nordhorn ohne Zuschauer
[metaslider id=10234] Der sechste Spieltag der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga beschert der MT Melsungen das dritte Heimspiel dieser Saison: Am Sonntag erwarten die Nordhessen die HSG [more…]
Lockdown mit Augenmaß
[metaslider id=10234] (ots) Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen fordert im Zuge eines zweiten Lockdowns planbare Operationen und Interventionen in erforderlichem Umfang unter strenger Indikationsstellung weiterzuführen. [more…]
Kontocheck am Weltspartag
[metaslider id=20815] Zum 95. Mal findet am heutigen Freitag (30. Oktober) der Weltspartag statt, einem internationalen Tag zur Förderung des Spargedankens. Doch Sparen ist [more…]
Mercedes flüchtet rasant und rücksichtslos vor Polizeistreife: 33-Jähriger nach Verfolgung geschnappt
[metaslider id=10234] (ots) Kassel: Vermutlich weil er keinen Führerschein hat, ist am Mittwochabend in Kassel ein 33-Jähriger mit seinem Auto rasant und rücksichtslos vor einer [more…]
Subaru feiert 40. Geburtstag in Deutschland Teil 7 – Mit eingebauter Fahrspaßgarantie
[metaslider id=96177] Subaru WRX STI als Erfolgsbasis im Motorsport Straßenversion mit großem Heckflügel und bis zu 300-PS-Boxer Weitere sportliche Modelle wie XT, SVX und BRZ [more…]
Benzin und Diesel günstiger als in der Vorwoche
[metaslider id=10234] Auch Rohölnotierungen rückläufig Die Kraftstoffpreise gehen im Bundesvergleich weiter zurück. Das ergibt die aktuelle Marktauswertung des ADAC. Demnach kostet ein Liter Super E10 [more…]
Drei Wohnungseinbrüche in Fuldatal und Wolfsanger: Kasseler Kripo sucht Zeugen
[metaslider id=10234] (ots) Fuldatal und Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke: Am Dienstag kam es in Fuldatal-Ihringshausen und dem Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke zu drei Wohnungseinbrüchen. Konkrete Hinweise, dass die Taten [more…]
Jetzt die Weichen für eine naturverträgliche Energiewende stellen
[metaslider id=20815] Heute findet bereits zum sechsten Mal das von der EU-Kommission ausgerichtete Kopenhagen-Forum zu Energie-Infrastrukturprojekten statt. Im Mittelpunkt steht das Versprechen, den Grean [more…]
Knapp 1000 Fahrzeuge überprüft und 50 sichergestellt: Bilanz der Schwerpunktkontrollen der AG Poser
[metaslider id=10234] (ots) Kassel/ Nordhessen: Eine positive Bilanz ziehen die Beamten der AG Poser der Direktion Verkehrssicherheit des Polizeipräsidiums Nordhessen, die seit Mitte Mai fortgesetzte [more…]
Bad Zwesten – Lobbyarbeit für finanzielle Unterstützung der Heilbäder und Kurorte
[metaslider id=20815] Bürgermeister Michael Köhler und die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes Almut Boller nahmen an der Besprechung mit dem Hessischen Finanzminister Michael Boddenberg teil. [more…]
ESA – Philaes zweiter Aufsetzpunkt an totenkopfförmigem Kamm entdeckt
[metaslider id=20815] Nach Jahren akribischer Detektivarbeit ist der zweite Aufsetzpunkt des Rosetta-Landers Philae auf dem Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko ausgemacht worden – an einem Ort, der [more…]
Neue Maßnahmen, altes Problem: Wo bleibt der Parlamentsbeschluss?
[metaslider id=10234] Statement des Deutschen Anwaltvereins (DAV) zu den neuen Corona-Maßnahmen Die von den Regierungsspitzen von Bund und Ländern soeben beschlossenen neuen Corona-Eindämmungsmaßnahmen müssen endlich [more…]
KSV Hessen Kassel – Evljuskin geht, Urban kommt
[metaslider id=10234] Verstärkung in der Innenverteidigung für die Löwen. Robin Urban (26) wird die Innenverteidigung des KSV verstärken, da nach sieben Jahren beim KSV [more…]
Stadt Kassel weitet Maßnahmen aus: Maskenpflicht im Schulunterricht
[metaslider id=10234] An weiterführenden Schulen in Kassel sind aktuell Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufgetreten. Aus diesem Grund weitet die Stadt Kassel die [more…]
Bad Zwesten – Einbruchsserie in Bad Zwesten
[metaslider id=10234] Bad Zwesten – Bei einer Einbruchsserie in Bad Zwesten wurde ein Sachschaden in unbekannter Höhe angerichtet. Im Zeitraum vom 25. Oktober 12:00 [more…]
MT Melsungen – Hobby-Handballer als Spielerpate eines MT-Profis
[metaslider id=10234] Die Gründe, warum sich ein Unternehmen als Sponsor bei einem Proficlub engagiert, sind so facettenreich wie die Wirtschaft und der Sport selbst. [more…]
Onlineveranstaltung – Verschwörungsideologien im (Bildungs-)Alltag
[metaslider id=10234] In Krisenzeiten haben Verschwörungsideologien Hochkonjunktur. Dieser Grundsatz trifft auch für die Corona-Pandemie zu. Doch wie kann man in Gesprächen auf entsprechende Äußerungen reagieren? [more…]
Weniger Verkehrsunfälle in der Corona-Krise: Rückgang von 26 % von März bis Juni 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
[metaslider id=10234] WIESBADEN – Seit März beeinflusst die Corona Pandemie das Leben in Deutschland. Lockdown, Homeoffice und Kontaktbeschränkungen haben die Mobilität verändert. Wie das Statistische [more…]
Halloween: Streiche und ihre Folgen
[metaslider id=10234] Vom Streich zur SachbeschädigungWenn Kinder und Jugendliche dieses Jahr trotz der derzeitigen Corona-Situation Halloween feiern und am Abend vor Allerheiligen als Hexen oder [more…]
Eindeutige Botschaft an die EU
[metaslider id=10234] Heute ist Halbzeit der von der Europäischen Kommission einberufenen Konsultationsphase für ein mögliches Gesetz gegen den Import von Produkten aus umweltzerstörerischer Produktion [more…]
Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Westendstraße und Annastraße
[metaslider id=10234] Aufgrund von Wartungsarbeiten an den Weichen der Straßenbahnschienen muss die Friedrich-Ebert-Straße muss zwischen Westendstraße und Annastraße von Donnerstag, 29. Oktober, 21 Uhr, bis [more…]
Welche Masken schützen wirklich vor COVID-19? Evidenzlage der Atemschutzmasken
[metaslider id=10234] (ots) Im Frühjahr gab es nicht genug standardisierte Masken und selbstgemachte Alltagsmasken waren eine sinnvolle Notlösung. Doch sie wurden zur Dauerlösung – trotz [more…]
Black Friday 2020: Schnäppchenjäger aufgepasst!
Werbung [metaslider id=10234] Der Black Friday stellt für viele Verbraucher das Shopping-Event des Jahres dar. In diesem Jahr findet der Black Friday am Freitag, dem [more…]
Essensboxen, Kaffeekapseln, Kosmetikflaschen: Die Zukunft heißt Mehrweg
[metaslider id=10234] (ots) Einwegverpackungen können praktisch immer und überall durch wiederverwendbare und klimafreundliche Mehrweg-Alternativen ersetzt werden. Das ist das Ergebnis der heutigen ersten Deutschen [more…]
Feuerwehr Kassel: Sichtbare Hausnummern retten Leben
[metaslider id=10234] Im Notfall kommen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst so schnell sie können – doch immer wieder haben sie Probleme, den Einsatzort schnell [more…]
Studie belegt: Mittlere Luftfeuchtigkeit in Räumen inaktiviert Viren und schützt vor Ansteckungen
[metaslider id=10234] (ots) Besonders in den Herbst- und Wintermonaten treten vermehrt Viruserkrankungen auf. Dass kalte, trockene Luft hierbei als Auslöser gilt, ist bekannt. Eine kürzlich [more…]
31-Jähriger ruft mehrfach Polizei auf den Plan: Festnahme bei Einbruch auf frischer Tat
[metaslider id=10234] (ots) Kassel: Ein bereits hinreichend bei der Polizei bekannter 31-Jähriger aus Kassel hat seit dem Montagabend gleich mehrfach die Kasseler Polizei beschäftigt. Zunächst [more…]
86 000 Tonnen Speisekürbisse wurden 2019 geerntet
[metaslider id=10234] WIESBADEN – Orange und omnipräsent – rund um Halloween kommt man an Kürbissen nicht vorbei. Gut 86 000 Tonnen Speisekürbisse wurden 2019 in Deutschland [more…]