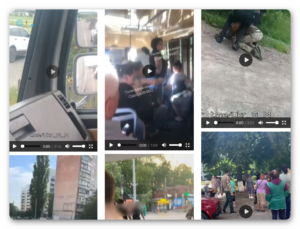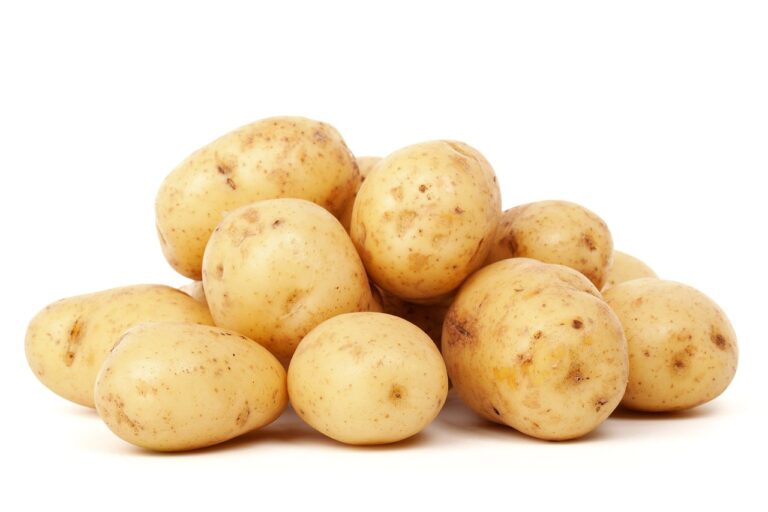Monat: Juli 2020

136 Tage ohne Landgang – Fregatte “Hamburg” bricht zum Einsatz “Irini” auf
[metaslider id=10234] (ots) Am Dienstag, den 04. August 2020 um 10 Uhr, läuft die Fregatte “Hamburg” für knapp fünf Monate in Richtung Mittelmeer aus. Dort [more…]
Schleck und weg, Nachhaltigkeit leider Fehlanzeige
[metaslider id=10234] Selbst minimalste Anforderungen an ökologische und soziale Nachhaltigkeit sind für die meisten deutschen Speiseeis-Produzenten weiterhin „kein Thema“. Das ist das Ergebnis einer Analyse des WWF Deutschland. Zum zweiten Mal [more…]
Unterrichtspaket zur Hautkrebsprävention kostenfrei bei der Deutschen Krebshilfe
Bonn/Köln (sts) – Das Projekt „CLEVER IN SONNE UND SCHATTEN – Für Grundschulen“ sensibilisiert Kinder der 3. und 4. Klassen altersgerecht für einen achtsamen Umgang [more…]
Das Bergische Land – Ein Geheimtipp für den Kurzurlaub
[metaslider id=10234] (ots) Viele Menschen suchen noch nach einem Reiseziel in Deutschland für den späten Sommer oder einen Kurzurlaub im Herbst. Das Bergische Land ist [more…]

Inge und Matthias Steiner verraten das Geheimnis ihrer Liebe
[metaslider id=10234] (ots) Allen Skeptikern zum Trotz feierten Olympiasieger Matthias Steiner, 37, und seine Ehefrau Inge, 50, gerade ihren 10. Hochzeitstag – in GALA (Heft [more…]

Tuning: Bei Spezialwünschen im Vorfeld von Experten beraten lassen
[metaslider id=10234] (ots) Breitere Reifen oder schicke Felgen sind für Tuningbegeisterte häufig der erste Schritt, um ihren Wagen einen individuelleres Erscheinungsbild zu verleihen. Eine Felge [more…]
Endenergieverbrauch in Hessen im Jahr 2018 wieder unter 800 Petajoule
[metaslider id=10234] Der Energieverbrauch in Hessen ist immer noch stark vom Mineralöl-Einsatz geprägt: Er hat im Jahr 2018 mehr als die Hälfte des Endenergieverbrauchs ausgemacht. [more…]

Leinen los für MS Wissenschaft
[metaslider id=10234] (ots) Tour des Ausstellungsschiffs MS Wissenschaft durch Deutschland startet am 30. Juli in Münster Am heutigen Donnerstag startet das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft im [more…]
Explodierende E-Zigarette durch Dienstschlüssel kein Arbeitsunfall
[metaslider id=10234] Düsseldorf/Berlin (DAV). Es liegt kein Arbeitsunfall vor, wenn sich der in der Hosentasche mitgeführte E-Zigaretten-Akku entzündet. Auch dann nicht, wenn dieser aufgrund eines [more…]
Neues Bundesjagdgesetz läuft ins Leere – noch mehr Abschüsse sind keine Lösung
[metaslider id=10234] (ots) Klöckners seit dieser Woche vorliegender Referentenentwurf zur Novellierung des Bundesjagdgesetzes beabsichtigt mittels der Jagd die Versäumnisse der Forstpolitik der vergangenen Jahrzehnte [more…]
Durch Sport und Spiel den sozialen Frieden sichern: KfW unterstützt syrische Flüchtlingskinder mit 25 Mio. EUR
[metaslider id=10234] (ots) – Rund 120.000 Kinder und Jugendliche profitieren in 12 Provinzen von Sport- und Freizeiteinrichtungen – Sozialer Zusammenhalt von türkischer Bevölkerung und syrischen [more…]
Biotonnen im Sommer
[metaslider id=10234] Im Sommer gehen manche Menschen mit einem mulmigen Gefühl zur Biotonne. Denn in den Kunststofftonnen sammeln sich besonders nach schwülwarmen Tagen gerne lästige [more…]

ADAC: Achtung vor Abzocke im Urlaub
[metaslider id=10234] (ots) Die ADAC Versicherung AG warnt erneut vor falschen Pannenhelfern, die sich als Gelbe Engel ausgeben und Reisenden viel Geld für Abschlepp- [more…]
Etwa ein Fünftel der stationär behandelten Covid-19-Patienten sind verstorben
[metaslider id=10234] Erste deutschlandweite Analyse auf Basis abgeschlossener Krankenhausfälle (ots) Etwa ein Fünftel der Covid-19-Patienten, die von Ende Februar bis Mitte April 2020 in deutschen [more…]

Wie werden wir nach Corona arbeiten
[metaslider id=10234] (ots) Obwohl viele Maßnahmen gelockert wurden, arbeiten manche von uns seit Corona nach wie vor im Homeoffice. So lange es keinen Impfstoff [more…]
BRABUS veredelt die neue Mercedes GLB-Klasse
[metaslider id=10234] Aerodynamik, Räder, Fahrwerk, Motortuning, Interieur Elegant gestylte Aerodynamik-Komponenten, Leichtmetallräder in 18, 19 oder 20 Zoll Durchmesser, sportlich-komfortable Fahrwerkslösungen, die den SUV höher- oder [more…]
Endlich Verbot von langen Tiertransporten in Drittländer
[metaslider id=10234] Der Deutsche Tierschutzbund und sein Landesverband Rheinland-Pfalz begrüßen die Entscheidung des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF), Transporte von [more…]
Der Polizeiladen jetzt “Open Air”
[metaslider id=10234] (ots) Im Zuge der Corona-Pandemie musste das vielen Bürgerinnen und Bürgern in Nordhessen bekannte Angebot der Beratungsstelle für Kriminal- und Verkehrsprävention im Polizeiladen [more…]
Neue Regeln für Lebensmittelkontrollen: “Julia Klöckner ebnet den Weg für den nächsten Lebensmittelskandal”
[metaslider id=10234] Berlin – Das Bundeskabinett hat heute neue Regeln für Lebensmittelkontrollen verabschiedet. Die Neufassung der sogenannten “Allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmen-Überwachung“ (AVV RÜb) sieht für die [more…]
“Ausserirdischer” ? Kornkreis aufgetaucht am Ammersee
[metaslider id=10234] In Fischen am Ammersee ist ein merkwürdiger Kornkreis in einem Weizenfeld aufgetaucht. Wer steckt dahinter? Die Besucher sind sich einig, dass da was [more…]
Was sind die Geschäftsbedingungen in einem Online-Casino?
WERBUNG [metaslider id=10234] Es ist wirklich wichtig, sich die Geschäftsbedingungen eines Online-Casinos anzusehen, mit dem Sie zu spielen beabsichtigen, denn wenn Sie diese nicht im [more…]
“IM KREIS”: MT-Talk mit Vorstand, Trainer, Neuzugängen
[metaslider id=10234] Die Corona-Pandemie beeinflusst den Alltag in vielen Bereichen. Davon ist die Kommunikation eines Profisportclubs nicht ausgenommen. So wird Handball-Bundesligist MT Melsungen in [more…]
Kraftstoffpreise steigen an Diesel um 0,5 Cent teurer, Super E10 um 0,3 Cent
[metaslider id=10234] (ots) In dieser Woche ist ein leichter Anstieg der Kraftstoffpreise zu verzeichnen. Der ADAC ermittelt für einen Liter Super E10 im bundesweiten Mittel [more…]
Außergewöhnliche Pilgerreise nach Mekka
Die Coronavirus-Pandemie sorgt an den heiligen Stätten des Islam für strenge Hygiene- und Abstandsregeln. [metaslider id=10234]
72 Fässer mit Tierdärmen mangelhaft gesichert: Polizisten stoppen gefährliche Fahrt von Sattelzug
[metaslider id=10234] (ots) B 7/ A 44 (Helsa/ Hessisch Lichtenau): Die gefährliche Fahrt eines in Rumänien zugelassenen Sattelzugs auf der B 7 beendete am gestrigen [more…]
Sie fielen nur auf, weil sie keinen Alkohol tranken…
[metaslider id=10234] Schlechtes Briefing führt zu Eklat imVerhältnis zwischen Belarus und Russland Ein ganz offensichtlich schlechtes Briefing führte zu Enttarrnung von angeblichen 32 Söldnern der [more…]
Brand in Gebäuden mit Menschenleben in Gefahr
[metaslider id=10234] Gegen Mittag des gestrigen Tages kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmshöher Allee im Kasseler Stadtteil Wehlheiden. [more…]
Fußgänger findet Leiche im Kasseler Nordstadtpark
[metaslider id=10234] (ots) Am gestrigen Abend gegen 19:50 Uhr hat ein Fußgänger im Kasseler Nordstadtpark den Leichnam einer männlichen Person gefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt [more…]
Festnahme eines mutmaßlichen Mitglieds sowie eines mutmaßlichen Unterstützers der ausländischen terroristischen Vereinigung “Islamischer Staat (IS)
[metaslider id=10234] (ots) Die Bundesanwaltschaft hat gestern (28. Juli 2020) aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 23. Juli 2020 die deutsche und libanesische [more…]
Corona-Impfstoff – Phase III der Testreihe gestartet
[metaslider id=10234] Um einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus zu finden, gehen nun zwei weitere Kandidaten mit in die dritte Phase. Diese sind das [more…]
So lassen sich Beschwerden beim Wetterwechsel lindern
[metaslider id=10234] (ots) Etwa die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland leidet mehr oder weniger stark darunter, wenn das Wetter umschlägt. Das Wetter selbst macht zwar [more…]
WWF fordert mehr Freiheit für die Flüsse
[metaslider id=10234] Seit 1970 sind 1406 untersuchte Bestände wandernder Süßwasserfischarten weltweit um durchschnittlich 76 Prozent zurückgegangen. In Europa liegt der Rückgang sogar bei 93 [more…]
Unsere neuen Zahlen: Migration (Mikrozensus 2019)
[metaslider id=10234] Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Hessen Der Anteil der hessischen Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist weiter gestiegen: Ergebnissen des Mikrozensus 2019 zufolge lebten [more…]

Taschengeld-Report 2020: Deutsche Eltern setzen auf regelmäßige Beträge
[metaslider id=10234] (ots) Mit Geld umzugehen gehört zu den wichtigsten Lektionen, die ein junger Mensch fürs Leben lernen sollte. Das wissen auch die Eltern in [more…]
Wie kann man sich Sportwetten langfristig leisten? Kann mann sich Sportwetten langfristig überhaupt leisten?
[metaslider id=10234] Bei dieser Frage geht es eigentlich um zwei verschiedene Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. Wir dürfen die Angelegenheit jedoch nicht zu komplex [more…]

Unfall und was dann?
[metaslider id=10234] (ots) Ferienzeit ist Urlaubszeit. Wie in jedem Jahr quälen sich Autokolonnen über deutsche Straßen. Das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden, steigt. [more…]
Airbag-Jacken für Motorradfahrer im ADAC Test Alle Modelle überzeugen mit Schutzpotenzial – Unterschiede in der Handhabung
[metaslider id=10234] (ots) Unfälle haben für Motorradfahrer oftmals größere Auswirkungen als für Autofahrer. Bei einem Aufprall werden letztere nicht nur durch die Karosserie, sondern auch [more…]
Stickstoffdioxidbelastung hat sich in den 40 von der Deutschen Umwelthilfe beklagten Städten doppelt so stark verringert wie in Nicht-Klagestädten
[metaslider id=10234] (ots) DUH zieht positive Zwischenbilanz ihrer Arbeit zur Durchsetzung der Sauberen Luft in deutschen Städten: Bisher keine Klage verloren, 31 der 40 Verfahren [more…]
Aggressiver 22-Jähriger verletzt Polizist bei Festnahme nach Schlägerei
[metaslider id=10234] (ots) Kassel-Mitte: Ein 22-Jähriger hat am gestrigen Montagabend in der Kasseler Innenstadt bei seiner Festnahme wegen Körperverletzung einen Polizisten durch Tritte verletzt. Zwischen [more…]
Folgemeldung 2 zum Wohnhausbrand in Hofgeismar: Feuer vermutlich fahrlässig oder durch technischen Defekt verursacht: Waffen und Munition bei Löscharbeiten aufgefunden
[metaslider id=10234] (ots)Hofgeismar (Landkreis Kassel): Nach dem Brand, der sich am gestrigen Montagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, im Hofgeismarer Ortsteil Hümme ereignete, haben die Beamten des [more…]
Brand im Pflegeheim: Pflegepersonal rettet mehrere Bewohner aus Alten- und Pflegeheim
[metaslider id=10234] Am gestrigen Abend gegen 18:26 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Alten- und Pflegeheim in der Eberhard-Wildermuth-Straße in Kassel aus. Kurze Zeit [more…]
Drei Milliarden tote und vertriebene Tiere in Australien
[metaslider id=10234] 143 Millionen Säugetiere, 2,46 Milliarden Reptilien, 180 Millionen Vögel und 51 Millionen Frösche – insgesamt fast drei Milliarden Tiere starben bei den [more…]
Wie ist das im Netz mit dem Recht auf Vergessen werden? BGH entscheidet
[metaslider id=10234] Bundesgerichtshof entscheidet über Auslistungsbegehren gegen den Internet-Suchdienst von Google (“Recht auf Vergessenwerden”) Entscheidungen vom 27. Juli 2020 – VI ZR 405/18 und VI [more…]
Bad Zwesten – Trinkstunde an der Löwenquelle mit musikalischer Begleitung
[metaslider id=10234] Bad Zwesten – Die Trinkstunde im Kurpark am Löwensprudel wird am Mittwoch den 29.Juli, dank dem Alleinunterhalter Horst Michel, wieder musikalisch untermalt. [more…]
Wald statt Meer: Reisejournalisten erkunden nordhessische Wälder
[metaslider id=10234] GrimmHeimat präsentiert sich als attraktive Reisealternative in Coronazeiten Unter dem Motto „Mythos Wald“ erkundeten Journalisten aus ganz Deutschland die GrimmHeimat NordHessen. Die bereits [more…]
Was flattert da im Hochsommer?
[metaslider id=10234] NABU: Insektensommer geht in die zweite Runde Wetzlar – Rund um das Beobachten, Bestimmen und Zählen von Insekten dreht sich alles bei der [more…]
Airbag-Jacken für Motorradfahrer im ADAC Test
[metaslider id=10234] Unfälle haben für Motorradfahrer oftmals größere Auswirkungen als für Autofahrer. Bei einem Aufprall werden letztere nicht nur durch die Karosserie, sondern auch [more…]
Greenpeace – Aktivistinnen und Aktivisten setzen Bemühungen um echten Meeresschutz vor Rügen fort
[metaslider id=10234] Weiterhin versenken die Umweltschützer von Greenpeace an Bord der „Beluga II“ die bis zu einer Tonne schweren Natursteine auf den Meeresboden des [more…]
Auslösewerte für Lärmsanierung werden gesenkt
[metaslider id=10234] Besserer Lärmschutz an Schiene und Straße: Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird die Auslösewerte für die Lärmsanierung an bestehenden Bundesfernstraßen und [more…]
USA – Corona Virus im Weißen Haus
[metaslider id=10234] Nun ist auch der Corona Virus im Weißen Haus angekommen. Robert O’Brien, seines Zeichens Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, hat sich nach [more…]