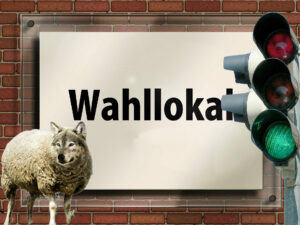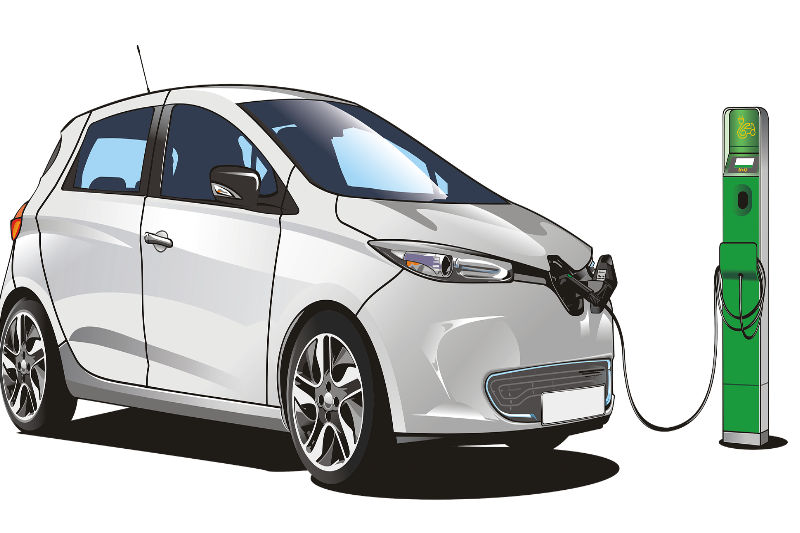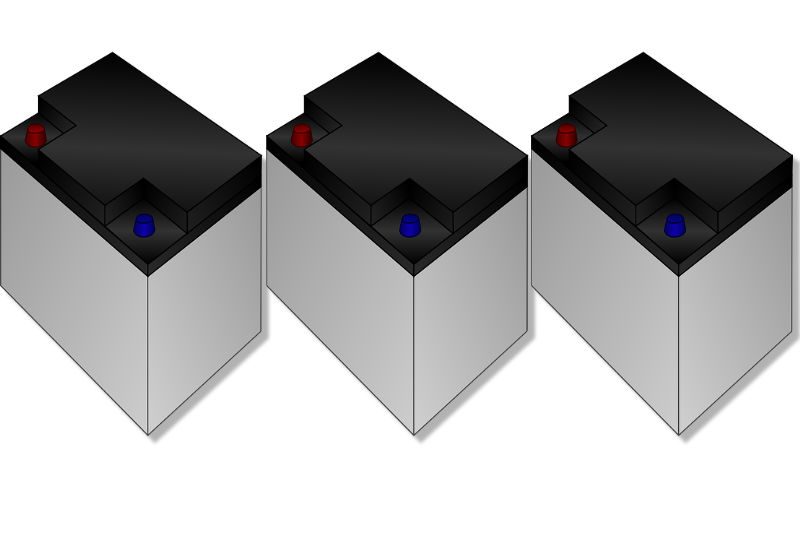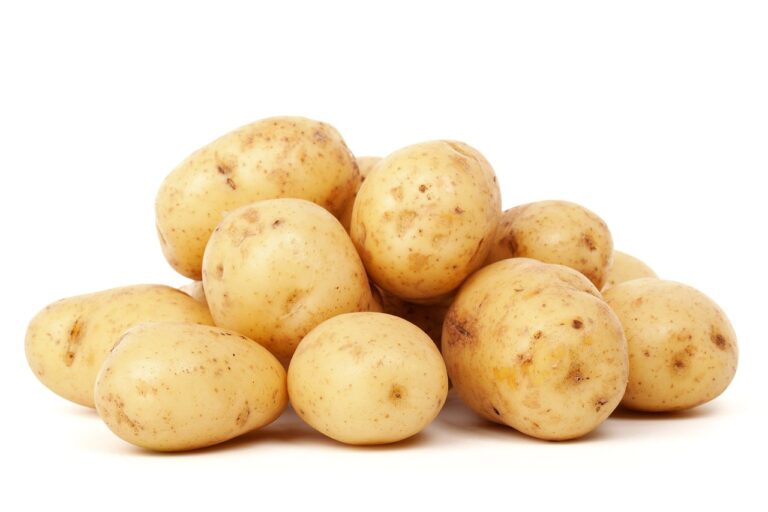Kategorie: E-Mobilität
Renault Scenic E-Tech Electric ist „Car of the Year 2024“
Der Scenic E-Tech Electric hat den Titel „Car of the Year 2024“ („Auto des Jahres 2024“) und damit die begehrteste Auszeichnung der Automobilbranche in Europa [more…]
Die elektrische Mercedes-Benz G-Klasse – Die Batterie
Sie ist das Herz eines jeden Elektrofahrzeugs – die Hochvoltbatterie. In der neuen elektrischen G-Klasse ist ein doppelstöckiger Lithium-Ionen-Akku mit 216 Zellen in zwölf Zellmodulen [more…]
Der neue EQV und die neue V-Klasse von Mercedes-Benz – Neues Cockpit-Design mit Hightech-Anmutung und zusätzliche Komfortausstattungen
Auch das Interieur-Design besticht mit einem aufgewerteten Look. Es steht im Zeichen der Digitalisierung. Das Cockpit ist vor allem gekennzeichnet durch eine neu gestaltete Instrumententafel [more…]
Fünf Jahre E-Scooter: Negative Schlagzeilen überschatten Jubiläum
Unfallzahlen mit E-Scootern steigen / Erhöhter Regulierungsbedarf in den Kommunen / ÖPNV-Betriebe verbieten Mitnahme Seit fünf Jahren sind E-Scooter auf deutschen Straßen zulässig, schon 2022 [more…]
Die neue elektrische Mercedes-Benz G-Klasse – Design und Ausstattung
Die neue elektrische G-Klasse steht ganz in der Designtradition der Baureihe und übernimmt die kantige Silhouette. Typische Details wie die markanten Türgriffe und die auf [more…]
Experte: Rund 100.000 E-Autos stehen in Deutschland auf Halde
Nach einer Analyse von Chemnitzer Autoexperten stehen Zehntausende Elektroautos in Deutschland auf Halde. Voriges Jahr habe es einen Rekordwert bei nicht verkauften Fahrzeugen gegeben, erklärte [more…]
Ladesäulen-Pflicht für Tankstellenketten geplant
Große Tankstellenketten in Deutschland sollen nach Plänen der Bundesregierung künftig zum Bau von Schnellladesäulen verpflichtet werden. Das Bundeskabinett hat jetzt eine entsprechende Gesetzesänderung auf den [more…]
58 % mehr E-Autos im Jahr 2023 exportiert als im Vorjahr
WIESBADEN – Der Außenhandel mit Elektro-Autos gewinnt zunehmend an Bedeutung – vor allem die Exporte haben deutlich zugelegt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden [more…]
L steht für Langstrecke – Audi Q6L e-tron
Das vollelektrisch angetriebene Fahrzeug wird auf der Frühjahrsmesse in der chinesischen Hauptstadt als Exterieurmodell gezeigt. Die Serienversion soll dann im vierten Quartal 2024 der Öffentlichkeit [more…]
Nicht über 80 Prozent laden: gängige Fehler beim Laden vom E-Auto
Elektroautos sind auf dem Vormarsch, doch die richtige Akkupflege ist eine Herausforderung. Einige Fehler können der Lebensdauer des Akkus schaden. Mit diesen Tipps hält der [more…]
ADAC Pannenstatistik 2024
Elektrofahrzeuge weiterhin zuverlässig / Starterbatterie bleibt Pannenursache Nummer eins / ADAC Pannenhilfe rückt alle neun Sekunden aus Elektrofahrzeuge mit Erstzulassung 2021 schneiden mit rund 3,6 [more…]
Nun wird’s richtig interessant – Akkuspeicher bis zu 180 KW am Haus
Was nutzt mir die Solarzelle auf dem Dach, wenn ich es nicht speichern kann? Eines der wesentlichsten Probleme der Menschheit momentan ist der Energiespeicher. Kleine [more…]
Strom für E-Autos kommt direkt aus dem Bordstein – Situation in Köln ist erbärmlich!
Freie Ladesäulen für E-Autos sind oft ein Problem, gerade in engen Großstädten. Dieses Pilotprojekt könnte Abhilfe schaffen. In Köln können Autofahrer ihr E-Auto an Ladestationen [more…]
Zwei Sitze, ein Akku und 45 km/h: Elektrische Mini-Autos im Test!
Sogenannte „Leichtkraftfahrzeuge“ sind kleine vollelektrische Stromer, die oft nur eine Reichweite von 75 Kilometern und Platz für zwei Personen haben. Aber wie gut kommt man [more…]
ADAC empfiehlt regelmäßige Wartung des Pedelecs
Mit E besser in die Werkstatt Fahrräder mit Motorunterstützung bringen meist ein paar Kilogramm mehr auf die Waage als herkömmliche Drahtesel – mehr Masse bedeutet [more…]
ADAC: E-Autos weiterhin stark rabattiert
(ots)Die im Dezember 2023 kurzfristig gestoppte E-Auto-Förderung hat teilweise zu hohen Hersteller-Rabatten geführt. Je nach Hersteller und Modell konnten Käufer mitunter mehrere Tausend Euro sparen, [more…]
Tempolimit und Elektrofahrzeuge
Warum Elektroautos von einem Tempolimit ausgenommen werden sollten Elektroautos haben in den letzten Jahren einen erheblichen Aufschwung erlebt, da die Welt nach umweltfreundlicheren Alternativen zum [more…]
Futuristisches Design: E-Bike kommt ohne Nabe, Speichen und Luftreifen
Aufmerksamkeit ist garantiert: Das Hubless E-Bike des südkoreanischen Herstellers Topsecret setzt auf eine ungewohnte Technik, denn das Bike hat weder Nabe noch Speichen. Auch Platten [more…]
Chinesischer Frachter bringt Tausende E-Autos nach Deutschland
Ein echtes Schwergewicht liegt gerade im Hafen von Bremerhaven (Bremen). Die „BYD Explorer No. 1“, das erste gecharterte Schiff des chinesischen Autoherstellers, hat auf seiner [more…]
E-Autos als Gebrauchtwagen sind unverkäuflich – Die drei Gründe
Gebrauchte E-Autos werden von Privatkunden nur selten gekauft. Stattdessen stehen sie beim Händler auf Halde. Lediglich 97.000 gebrauchte Elektroautos wurden vergangenes Jahr in Deutschland verkauft. [more…]
Laden in Mehrfamilienhäusern bereitet Probleme
Planung und Organisation größte Herausforderungen / Finanzierung ist oft eine weitere Hürde Seit der Änderung des Wohnungseigentumgesetzes (WEG) im Dezember 2020 können Mieter und Eigentümer [more…]
On Tour! E-Autos im Winter energiesparend fahren
Mit den sinkenden Temperaturen steigt bei E-Autos der Energieverbrauch. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten Energie zu sparen, sogar während der Fahrt. Matthias Vogt vom ADAC [more…]
Bei der Errichtung eines Wohngebäudes MÜSSEN nun die Ladevorrichtungen bereitgestellt werden!
Ja, das ist nun Pflicht. Baut man ein Haus mit mehreren Stellflächen so müssen zumindest die Schutzrohren für Elektrokabel bereits vorhanden sein. Da man mittlerweile [more…]
Macan setzt neue Maßstäbe – erstes vollelektrisches SUV von Porsche
Zehn Jahre nach seiner Markteinführung startet der Porsche Macan vollelektrisch in die zweite Modellgeneration. Durch progressives, zeitloses Design, markentypische Performance, langstreckentaugliche Reichweite und hohe Alltagstauglichkeit [more…]
Verkaufsstart des Polestar 4
GÖTEBORG, SCHWEDEN – 18. April 2023. Polestar (Nasdaq: PSNY) stellt Polestar 4 vor, ein elektrisches Performance SUV Coupé und das zweite SUV im Portfolio der [more…]
Tesla verliert die Spitzenposition
Tesla, der bislang größte Elektroauto-Produzent der Welt, hat im vierten Quartal 2023 seine Spitzenposition an den chinesischen Konkurrenten BYD verloren. Tesla verkaufte von Oktober bis [more…]
Förderstopp: Zulassungszahlen brechen ein
(ots)Im Dezember 2023 wurden laut der aktuellen Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) knapp 242.000 Fahrzeuge neu zugelassen. Das sind 72.000 Einheiten und damit fast ein Viertel [more…]
Untersuchung: E-Mobilität lässt Strombedarf rasant steigen
Durch die ständige Zunahme an elektrischen Autos und Lastwagen in Europa dürfte der Stromverbrauch von heute 16 Terawattstunden auf 355 Terawattstunden im Jahr 2040 steigen. [more…]
Mercedes-Benz setzt Boni für Elektromobilität auch nach Wegfall des Umweltbonus fort
Aufträge bis zum 31.12.2023 werden von Mercedes-Benz weiterhin mit dem Herstelleranteil gefördert Für Lieferungen und Zulassungen zwischen dem 18.12. und 31.12.2023 übernimmt Mercedes-Benz neben dem [more…]
Blitzumfrage im Autohandel: Rund 60.000 Fahrzeuge vom Förderstopp betroffen
(ots)Vom plötzlichen Stopp des Umweltbonus sind rund 60.000 E-Fahrzeuge betroffen. Das hat eine aktuelle Blitzumfrage des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ergeben, die am 18. und [more…]
Ende des Umweltbonus: Bundesregierung schädigt tausende Bundesbürger
Ende des Umweltbonus: Bundesregierung schädigt Kunden und Autohändler (ots)Autokunden und Händler sind schockiert: Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) können mit Ablauf des [more…]
Elektrofahrzeuge weiter auf dem Vormarsch
Man kann darüber denken wie man will und ja es gibt noch Vorbehalte. Insbesondere wenn man an die Energiepolitik dieser unsäglichen Regierungstruppe denkt, mag man [more…]
Autoantriebe – Elektro holt auf
Pkw mit elektrischen Antrieben stellen einen immer größeren Anteil an den Neuzulassungen in Deutschland. Das zeigt die Statista-Animation auf Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts. So [more…]
Winter-Tipps für Elektroauto-Fahrer ADAC: Auch bei niedrigen Temperaturen keine Angst vor Staus
Vorheizen erhöht die Reichweite (ots)Nähern sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt, bekommen viele Elektroautofahrer sprichwörtlich kalte Füße: Mit sinkenden Gradzahlen steigt die Angst vor schwindender Reichweite [more…]
On Tour! Mit dem E-Auto zuverlässig durch den Winter
Die Temperaturen sinken – der Energieverbrauch steigt. Elektro-Fahrzeuge verbrauchen im Winter bis zu 30 Prozent mehr Strom. Was man tun kann, um auch im Winter [more…]

E-Bike: Viele riskieren Fahrsicherheit
Ladeverluste bei E-Autos ADAC untersucht, wie viel Strom beim Laden verloren geht
[metaslider id=10234] (ots) Elektroautos ziehen beim Laden mehr Energie aus dem Stromnetz als in der Batterie gespeichert wird. Während bei vielen elektrotechnischen Geräten der Wirkungsgrad [more…]
Europäische Mobilitätswoche – Mobilitätstag lädt zum Mitmachen ein
[metaslider id=10234] Zum diesjährigen Auftakt der Europäischen Mobilitätswoche lädt das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt mit vielen Partnerinnen und Partnern am Samstag, 17. September 2022, von 10 [more…]
Volocopter kooperiert mit Microsoft beim VoloIQ Aerospace Cloud Projekt
[metaslider id=10234] (ots/PRNewswire) Volocopter, Pionier der Urban Air Mobility (UAM), gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit Microsoft bei der Entwicklung eines Aerospace Cloud Systems auf [more…]
Neu: Lastenrad im E-Bike-Programm der ADAC SE
[metaslider id=10234] Kompaktes Metz-Lastenrad “Made in Germany” bei ADAC e-Ride Robustes, variables Trägersystem mit hoher Zuladung Preisvorteil für ADAC Mitglieder (ots) Unter dem Namen [more…]
Kein verfrühter Förderstopp bei rein batterieelektrischen Fahrzeugen
[metaslider id=10234] (ots)Hinsichtlich der von Bundeswirtschaftsminister Habeck beabsichtigten Veränderung bei der Förderung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb warnt der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, vor einem verfrühten Ende [more…]
Der Brand der Felicity Ace und die Rolle der Akkus
[metaslider id=10234] Seit Tagen brennt der Autofrachter Felicity Ace (HIER) vor den Azoren im Atlantik vor sich hin. An Bord sind ca. 4000 [more…]
Mobilität und Klimaschutz zusammenbringen
[metaslider id=10234] Ambitionierte Ziele bei E-Mobilität und öffentlichem Verkehr – positive Signale für alternative Kraftstoffe Der ADAC hält den Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP [more…]
Schnellladen noch mit Verbesserungspotential
[metaslider id=10234] ADAC Umfrage zum Laden an der Langstrecke: Ausbau der Ladeinfrastruktur und einfachere Abläufe sind E-Autofahrern besonders wichtig Auch wenn die Schnellladeinfrastruktur in den [more…]