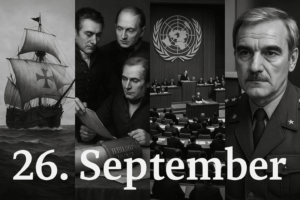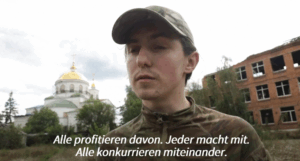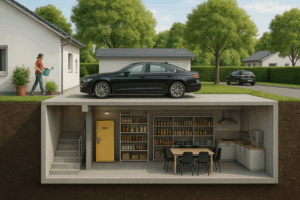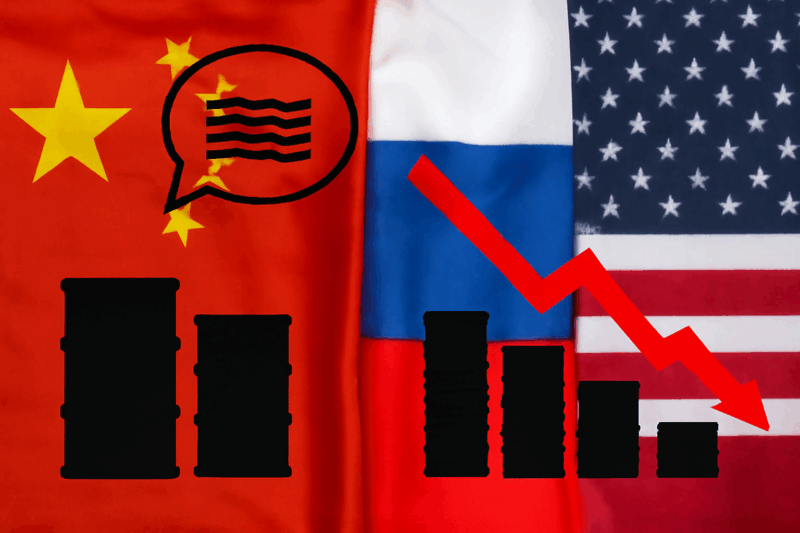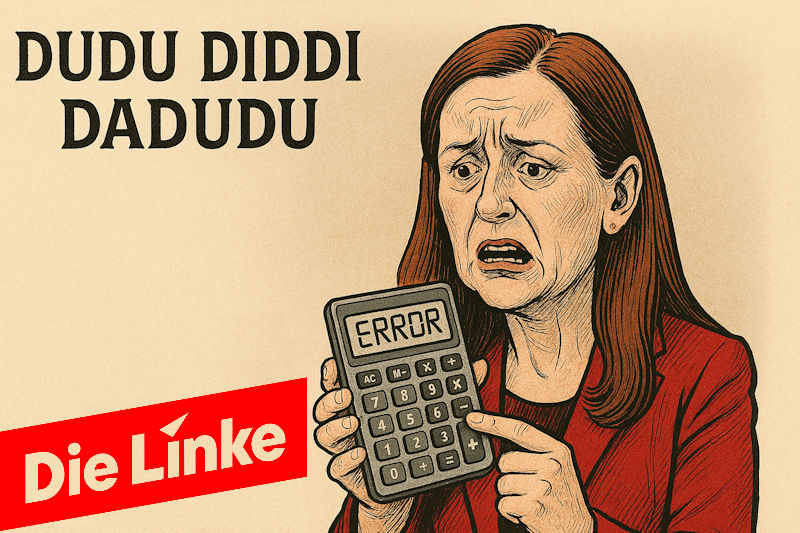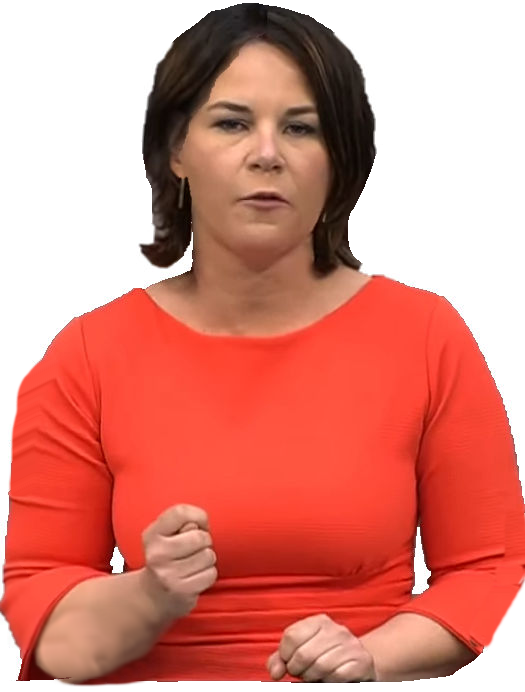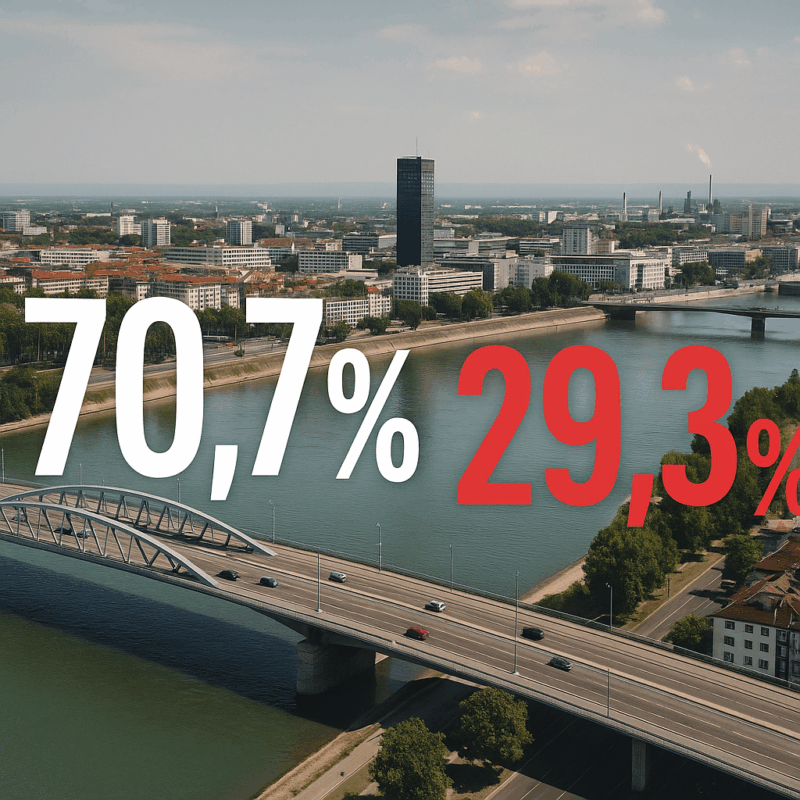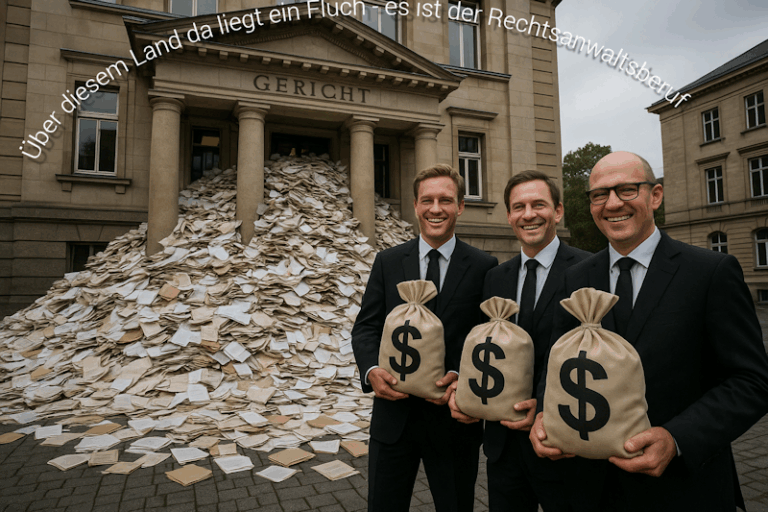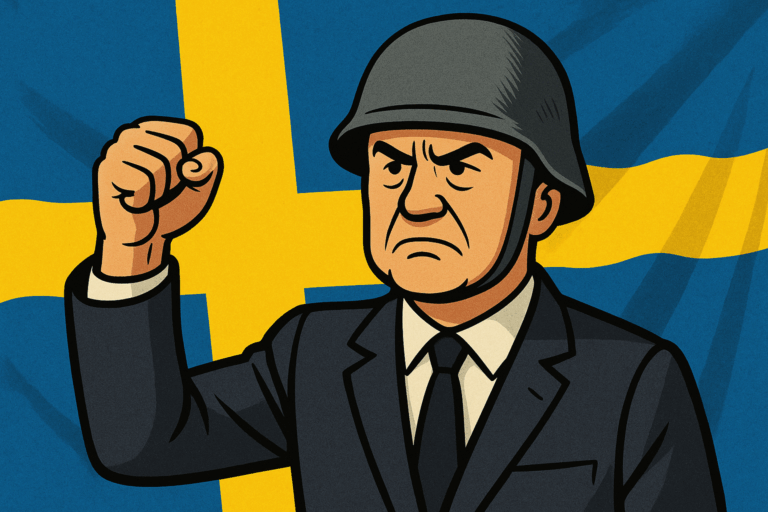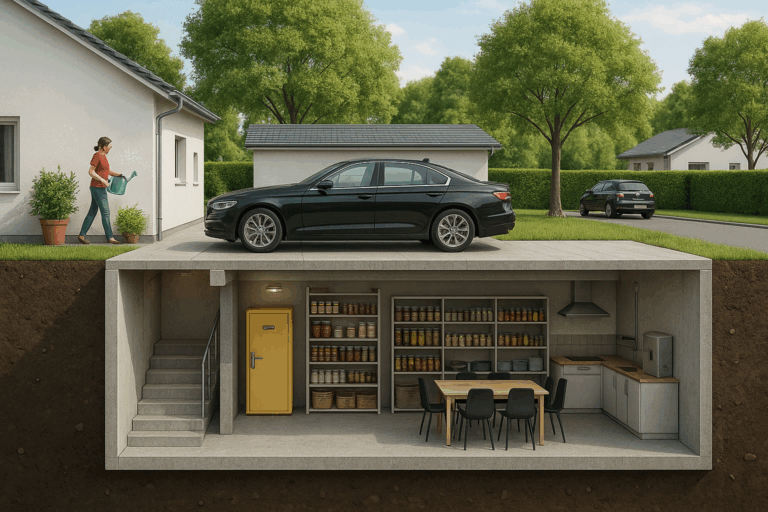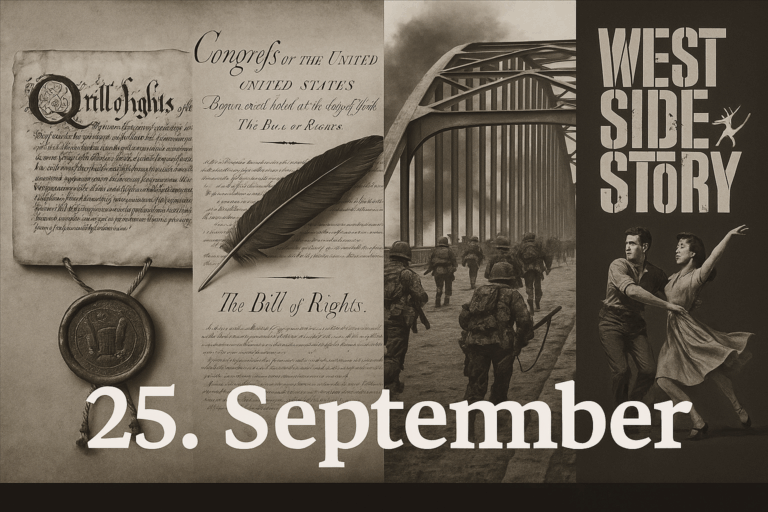Essay: Abu Walaa – Der „IS-Prediger“ aus Hildesheim und das doppelte Gesicht des radikalen Islamismus in Deutschland
Abu Walaa, mit bürgerlichem Namen Ahmad Abdulaziz Abdullah A., galt lange Zeit als einer der einflussreichsten salafistischen Prediger Deutschlands. Bekannt unter dem Beinamen „der IS-Prediger“, wirkte der gebürtige Iraker wie ein Schattenmann: öffentlich kaum sichtbar, aber in der Szene bestens vernetzt. Sein Fall ist ein Paradebeispiel dafür, wie religiöser Fanatismus unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit Fuß fassen und junge Menschen ins Verderben reißen kann – mitten in Deutschland.
Der Aufstieg eines Hasspredigers
Abu Walaa betrieb in Hildesheim ein islamisches Kulturzentrum, das nach außen hin als Ort der religiösen Bildung auftrat. Doch hinter den Kulissen entwickelte sich das Zentrum zu einem Rekrutierungsort für den sogenannten Islamischen Staat. Er selbst trat selten in Erscheinung. Kein Gesicht, kaum Interviews – seine Predigten veröffentlichte er zumeist anonym über das Internet. Dieses bewusste Vermeiden der Öffentlichkeit machte ihn für die Ermittlungsbehörden lange schwer greifbar. Aber sein Einfluss war beträchtlich.
Seine Botschaft war klar: ein fanatischer, dogmatischer Islam, der keinen Widerspruch duldet und den Westen als moralisch dekadent und feindlich darstellt. Besonders junge Männer wurden von ihm angesprochen – oft in prekären Lebenssituationen, orientierungslos, empfänglich für einfache Antworten und große Versprechen.
Die Netzwerke – subtil, aber gefährlich
Abu Walaa war kein Einzeltäter. Er war eingebettet in ein Netz von Helfern und Gesinnungsgenossen. Gemeinsam mit mehreren Mitangeklagten half er jungen Muslimen, sich dem IS anzuschließen – unter anderem auch dem späteren Attentäter von Berlin, Anis Amri. Die Anklage gegen ihn stützte sich unter anderem auf Aussagen eines Aussteigers, der verdeckt mit den Behörden zusammenarbeitete. Dieser sagte aus, dass Abu Walaa als zentrale Figur bei der Radikalisierung und Ausreisevorbereitung von IS-Kämpfern fungiert habe.
Dass so etwas in einem Land wie Deutschland möglich war – über Jahre hinweg – ist ein Armutszeugnis für die staatliche Präventions- und Kontrollarbeit. Zwar waren seine Aktivitäten bekannt, aber die Beweislage war lange zu dünn. Erst als sich mehrere Kronzeugen meldeten, konnte die Justiz eingreifen.
Die Justiz greift – spät, aber konsequent
Im November 2020 wurde Abu Walaa vom Oberlandesgericht Celle zu einer Freiheitsstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt – wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Unterstützung terroristischer Straftaten und Anstiftung zur Ausreise in ein Kriegsgebiet. Das Urteil war ein deutliches Zeichen, dass der Rechtsstaat durchaus handlungsfähig ist – aber auch, dass er oft zu spät handelt.
Denn die eigentliche Gefahr liegt nicht allein in Figuren wie Abu Walaa, sondern in den Strukturen, die es solchen Predigern ermöglichen, unter dem Radar zu agieren: unkontrollierte Moscheen, mangelhafte Aufsicht über gemeinnützige Vereine, wenig koordinierte Deradikalisierungsprogramme. Dazu kommt eine politische Scheu, religiösen Fanatismus konsequent beim Namen zu nennen – aus Angst, pauschal Muslime zu diffamieren.
Der doppelte Standard im Umgang mit Extremismus
Abu Walaa ist auch ein Lehrstück über die ungleiche Behandlung von Extremismus. Während Rechtsextreme zu Recht unter scharfer Beobachtung stehen, wurde islamistischer Extremismus jahrelang eher als Randphänomen behandelt – oder gar kulturell relativiert. Die Tatsache, dass viele IS-Anhänger in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind, hätte früher zu einer ehrlicheren Debatte führen müssen: über Integration, Bildungsversagen, Parallelgesellschaften und die Rolle radikaler Prediger, die sich als religiöse Autoritäten tarnen.
Die deutsche Politik scheint hier oft mit angezogener Handbremse zu agieren. Abu Walaa war kein Einzelfall – er war nur einer der sichtbareren. Die Szene lebt weiter, digitalisiert, vernetzt, oft besser organisiert als die Behörden, die sie bekämpfen sollen.
Fazit: Wachsamkeit statt Naivität
Der Fall Abu Walaa mahnt zur Wachsamkeit ohne Pauschalisierung. Religiöse Freiheit ist ein hohes Gut – aber sie darf kein Freibrief für Hass, Radikalisierung und Gewaltverherrlichung sein. Wenn der Rechtsstaat hier zu zaghaft bleibt, untergräbt er seine eigenen Prinzipien. Prediger wie Abu Walaa rekrutieren keine Terroristen mit Waffen – sondern mit Worten. Doch Worte können tödlich sein.
Deshalb braucht es mehr Mut zur Klarheit, weniger politische Korrektheit, und ein konsequentes Vorgehen gegen Strukturen, die Extremismus Vorschub leisten. Der Fall Abu Walaa darf kein Einzelfall bleiben – weder in der Wahrnehmung, noch in der Aufarbeitung.